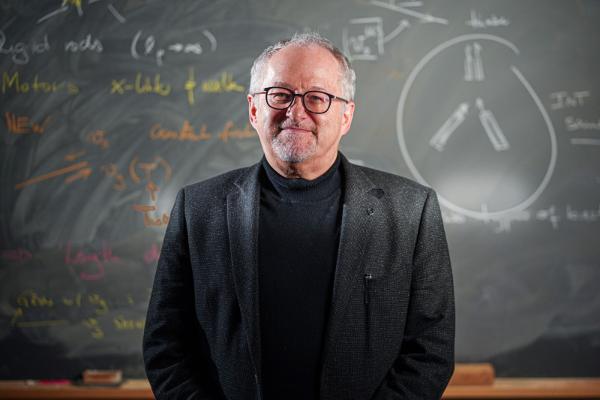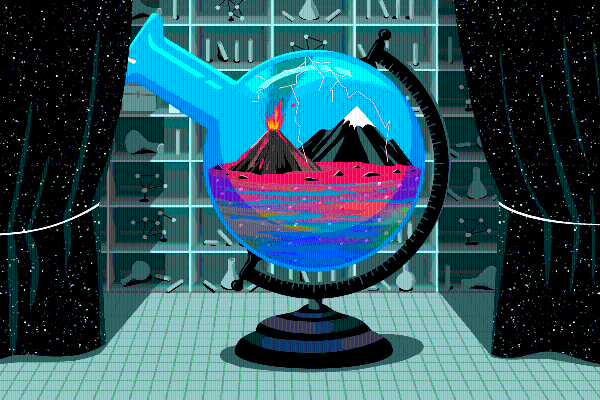LMU Newsroom
Was ist los an der LMU? Alles auf einen Blick im LMU Newsroom – News, Events, Interviews, Hintergründe, Geschichten.

Angebote zum Semesterstart im LMU-Shop
Bis zum 21. April gibt es 10% auf fast alle Produkte im LMU-Shop. Da ist für jeden aus der LMU-Community etwas dabei.
Weiterlesen
ERC Advanced Grant für Politikwissenschaftler Christoph Knill
Wie wirkt sich eine dauerhafte Krise auf die Politikgestaltung aus? Der Europäische Forschungsrat fördert ein LMU-Projekt dazu.
Weiterlesen
Veranstaltung | KinderUni: Leben in der Bronzezeit
26.04.24 | Vor gut 4000 Jahren begann in Süddeutschland die Bronzezeit – aber wie haben Kinder in dieser Zeit gelebt und diese Zeit erlebt?
WeiterlesenEINSICHTEN. Das Forschungsmagazin

"Echt jetzt" – der neue EINSICHTEN-Schwerpunkt
Die neue Ausgabe des Forschungsmagazins EINSICHTEN ist erschienen, mit dem Schwerpunktthema: „Echt jetzt - natürlich, künstlich: Die Grenzen verschwimmen“. Hier können Sie das Magazin als E-Paper lesen.
Weiterlesen
Pflanzen im planetaren Stresstest
Der globale Wandel bringt die Erde an ihre Belastungsgrenze. Im EINSICHTEN-Interview diskutieren die Geographin Marianela Fader und der Biologe Dario Leister, wie sich Natur und Landwirtschaft an veränderte Lebensräume anpassen oder anpassen lassen.
Weiterlesen
„Wenn Erfolg den Selbstwert setzt“
Wie viel gut machen ist nicht mehr gut? Barbara Cludius erforscht den Hang zum Perfektionismus. Im EINSICHTEN-Interview erklärt sie, wie ein schädliches Gedankenkonstrukt mit verschiedenen psychischen Störungen zusammenhängt.
WeiterlesenNewsletter und RSS-Feeds

© LMU
Bestens informiert mit dem LMU-Newsletter: Der Newsletter erscheint monatlich und bietet einen Einblick, was an der LMU los ist: Worüber wird an der LMU geforscht? Welche Projekte werden gefördert? Was beschäftigt gerade Studierende?
Wollen Sie über Neues an der LMU auf dem Laufenden sein? Dann melden Sie sich einmalig beim Newsletter „LMU aktuell“ an. Von der kommenden Ausgabe an wird er Ihnen automatisch monatlich ins E-Mail-Postfach gesendet.
RSS Feed News oder Veranstaltungen abonnieren: